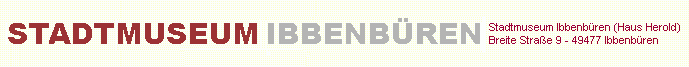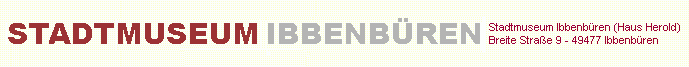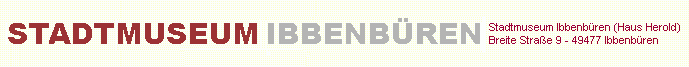
 |
 Sie sind hier:
Sie sind hier: Stadtgeschichte > Aufsätze zur Geschichte
Ibbenbürens > Schwefelbad Ledde |
| |
- Schwefelbad Ledde - 1882
- 1908
|
|
| |
Inhalt: Schwefelbad Ledde in der Presse -
Presse nach Datum des Erscheinens
|
|
| |
Schwefelbad
Ledde an der Windmühlenstr. 54,
|
|
| |
Nur Nummern erinnern an einstige
gute Zeiten
|
|
 |
|
 |
| |
Das Schwefelbad Ledde in seinen guten Jahren.
Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden
|
|
 |
 Quelle; 14.5.1882 - Westf. Nachrichten
Quelle; 14.5.1882 - Westf. Nachrichten
|
|
 |
Ledde. Am 14. Mai 1882
eröffnete der Gastwirt Ernst August Hannigbrink das Schwefelbad
Ledde. Das Hauptgebäude existiert heute noch. Es liegt hart
südlich der Autobahn E 8, in der Nähe zur Nachbargemeinde Westerkappeln.
Das Bad war vom Bahnhof Velpe aus bequem zu erreichen. Die dort
erbohrte Quelle nannte man "Hermannsquelle". Hier erlangten
viele Badegäste Linderung ihrer Leiden. Zur Freude der vielen
jungen Leute aus der weiten Nachbarschaft fanden hier oftmals
Tanzveranstaltungen statt. Nach 26 Jahren florierenden Geschäfts
verkaufte Ernst August Hannigbrink im Jahre 1908 das gesamte
Areal an den Georgsmarienhütten-Verein für 120 000 Mark. Im
Ersten Weltkrieg dienten die Gebäude einem anderen Zweck. Verwundete
Soldaten erhofften sich hier Genesung.
|
|
 |
 Quelle: 19.9.1986 - Westf. Nachrichten
Quelle: 19.9.1986 - Westf. Nachrichten
|
|
 |
|
 |
| |
Am 21. Mai 1901 ist diese Karte abgestempelt
worden. Die Vorderseite zeigt neben privaten Bemerkungen des
Absenders am oberen Rand das Schwefelbad Ledde um die Jahrhundertwende
in seiner ganzen Pracht.
|
|
 |
Heilung an der "Hermannsquelle"
Ledde.
Am 14. Mai 1882 eröffnete der Gastwirt Ernst August Hannigbrink
das Schwefelbad Ledde. Das Hauptgebäude existiert heute noch.
Es liegt hart südlich der Autobahn E 8, in der Nähe zur Nachbargemeinde
Westerkappeln. Das Bad war vom Bahnhof Velpe aus bequem zu erreichen.
Die dort erbohrte Quelle nannte man "Hermannsquelle". Hier erlangten
viele Badegäste Linderung ihrer Leiden. Zur Freude der vielen
jungen Leute aus der weiten Nachbarschaft fanden hier oftmals
Tanzveranstaltungen statt. Nach 26 Jahren florierenden Geschäfts
verkaufte Ernst August Hannigbrink im Jahre 1908 das gesamte
Areal an den Georgsmarienhütten-Verein für 120 000 Mark. Im
Ersten Weltkrieg dienten die Gebäude einem anderen Zweck. Verwundete
Soldaten erhofften sich hier Genesung.
|
|
 |
 Quelle: 16.3.1990 Westf. Nachrichten
Quelle: 16.3.1990 Westf. Nachrichten
|
|
 |
Anno 1907 präsentierte
sich das Schwefelbad in voller Pracht.
Da nagt der Zahn der Zeit… Das alte Schwefelbad war ehemals
ein modernes Haus mit Komfort - zeitweise war es Feldlazarett
Tecklenburger Land. Ein ganz besonders imposantes Gebäude im
Kreise Tecklenburg war zu Beginn dieses Jahrhunderts das Schwefelbad
in Ledde. Auf einer kleinen Anhöhe wurde es 1900 von A. Hanningbrink
erbaut. Es war ein großes und für die damalige Zeit modernes
Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren Schornstein
heute noch zu einem guten Teil erhalten ist. Im ersten Weltkrieg
wurde das Bad Ledde - wie viele andere Häuser ähnlicher Struktur
auch, zum Feldlazarett umgewandelt. Zu diesem Bad gehörten damals
große Ländereien. Nach dem Kriege ging das Schwefelbad in den
Besitz der GM-Hüttenwerke über. Im Jahre 1938 kaufte es Erwin
Bischof, der auch jetzt noch Besitzer des Anwesens ist, das
sich allerdings im äußeren Erscheinungsbild verändert hat.
|
|
 |
 Quelle: 8.8.1990 Westf. Nachrichten
Quelle: 8.8.1990 Westf. Nachrichten
|
|
| |
Brand
im alten Schwefelbad in Ledde
|
|
| |
300 000 DM Schaden
Hausbewohner kamen mit dem Schrecken davon |
|
| |
Tecklenburger Land.
Mindestens 300 000 DM Schaden
verursachte ein Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag im
Dachgeschoß des alten Schwefelbads Ledde. 30 Fahrzeuge und 120
Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu bekämpfen.
- Kurzfassung:
Nach Angaben des Zugführers Brönstrup war die Wasserversorgung
ein großes Problem. Zwar ist ein Hydrant und ein Teich in der
Nähe, doch beides reichte nicht aus.Weitere Wehren und eine
Drehleiter wurden angefordert. Die Feuerwehr verlegte eine 2
km lange Schlauchleitung bis zum Dorfteich. Gegen 01.30 Uhr
war das Feuer unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden,
aber der Eigentümer und seine Frau standen unter Schock. Als
Ursache für den Brand könnten Teerarbeiten am Montag auf dem
Dach infrage
|
|
|
 |
|
 |
| |
Nach dem Brand des Dachgeschosses sind die
Wohnungen im alten Schwefelbad aufgrund von
Wasserschäden nicht mehr bewohnbar.
|
|
 |
 Quelle;15.2.1998 Westf. Nachrichten
Quelle;15.2.1998 Westf. Nachrichten
|
|
 |
Ledder Schwefelbad wird
nach dem Brand (von 1990) im vergangenen Jahr nicht wieder aufgebaut
Tecklenburg-Ledde. Ein altes Haus - das Schwefelbad in Ledde
- ist nicht mehr! Das Bad war zu Beginn dieses Jahrhunderts
ein besonders imposantes Gebäude im Kreis Tecklenburg. Auf einer
kleinen Anhöhe war es 1900 von A. Hanningbrink erbaut worden.
Es war, wie alte Bilder zeigen für die damalige Zeit ein großes,
modernes Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren
Schornstein bis zum Brand noch gut erhalten war. Ende August
des letzten Jahres brannte es ab.
Das Feuer hatte so vollständige Arbeit geleistet, daß sich
ein Wiederaufbau als sehr kostspielig erwies. Jetzt ist es abgebrochen
- und wie das Bild zeigt, sind nur Trümmer von der einstigen
Schönheit übriggeblieben. Von dieser Schönheit zeugt heute noch
der Rest der ehemaligen Kegelbahn, die damals sicher auch als
schönes Beiwerk in den Rahmen des ganzen Bildes vom Bad Ledde
paßte. Im Ersten Weltkrieg wurde Bad Ledde - wie viele andere
Häuser ähnlicher Struktur auch - zum Feldlazarett umgewandelt.
Zu diesem Bad gehörten damals große Ländereien. Nach dem Krieg
ging das Schwefelbad in den Besitz der GM-Hüttenwerke über.
Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof das Anwesen. Er ist auch
jetzt noch Besitzer. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes
hatte sich im Laufe der Jahre verändert, aber noch immer war
die Größe des Hauses und, durch die Wirtschaftsgebäude bedingt,
auch die Größe des Besitztums zu erkennen. Das Haupthaus aber
ist jetzt nicht mehr. Dem Vernehmen nach will Erwin Bischof
hier wieder ein kleineres Anwesen erbauen. Ein bedeutsamer Zeuge
der Vergangenheit des Schwefelbades Ledde aber wurde ein Raub
der Flammen und ist unwiederbringlich verloren.
|
|
 |
|
 |
| |
Das Schwefelbad Ledde in seinen guten Jahren.
Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden Aus der großen Zeit
des Schwefelbades kündet noch das Mauerwerk der alten Kegelbahn
|
|
 |
|
 |
| |
So sah das große Haus vor dem Brand
aus. August 1990
|
|
 |
|
 |
| |
... und das ist davon ubriggeblieben; der
Bauschut dtes Gebäudes
|
|
 |
Mindestens 300 000 DM Schaden
verursachte ein Brand in der Nacht von Montag auf Dienstag im
Dachgeschoß des alten Schwefelbads Ledde. 30 Fahrzeuge und 120
Feuerwehrleute waren im Einsatz.
Kurzfassung:
Nach Angaben des Zugführers Brönstrup war die Wasserversorgung
ein großes Problem. Zwar ist ein Hydrant und ein Teich in der
Nähe, doch beides reichte nicht aus.Weitere Wehren und eine
Drehleiter wurden angefordert. Die Feuerwehr verlegte eine 2
km lange Schlauchleitung bis zum Dorfteich. Gegen 01.30 Uhr
war das Feuer unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden,
aber der Eigentümer und seine Frau standen unter Schock. Als
Ursache für den Brand könnten Teerarbeiten am Montag auf dem
Dach infrage kommen.
|
|
 |
 Quelle;15.2.1991 Westf. Nachrichten
Quelle;15.2.1991 Westf. Nachrichten
|
|
 |
Nur Trümmer erinnern an
einstige Schönheit Ledder Schwefelbad wird nach dem Brand (von
1990) im vergangenen Jahr nicht wieder aufgebaut
Tecklenburg-Ledde. Ein altes Haus - das Schwefelbad
in Ledde - ist nicht mehr! Das Bad war zu Beginn dieses Jahrhunderts
ein besonders imposantes Gebäude im Kreis Tecklenburg. Auf einer
kleinen Anhöhe war es 1900 von A. Hanningbrink erbaut worden.
Es war, wie alte Bilder zeigen für die damalige Zeit ein großes,
modernes Haus mit Galerien, Kegelbahn und einer Brauerei, deren
Schornstein bis zum Brand noch gut erhalten war. Ende August
des letzten Jahres brannte es ab.
Das Feuer hatte so vollständige Arbeit geleistet, daß sich ein
Wiederaufbau als sehr kostspielig erwies. Jetzt ist es abgebrochen
- und wie das Bild zeigt, sind nur Trümmer von der einstigen
Schönheit übriggeblieben. Von dieser Schönheit zeugt heute noch
der Rest der ehemaligen Kegelbahn, die damals sicher auch als
schönes Beiwerk in den Rahmen des ganzen Bildes vom Bad Ledde
paßte. Im Ersten Weltkrieg wurde Bad Ledde - wie viele andere
Häuser ähnlicher Struktur auch - zum Feldlazarett umgewandelt.
Zu diesem Bad gehörten damals große Ländereien. Nach dem Krieg
ging das Schwefelbad in den Besitz der GM-Hüttenwerke über.
Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof das Anwesen. Er ist auch
jetzt noch Besitzer. Das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes
hatte sich im Laufe der Jahre verändert, aber noch immer war
die Größe des Hauses und, durch die Wirtschaftsgebäude bedingt,
auch die Größe des Besitztums zu erkennen. Das Haupthaus aber
ist jetzt nicht mehr. Dem Vernehmen nach will Erwin Bischof
hier wieder ein kleineres Anwesen erbauen. Ein bedeutsamer Zeuge
der Vergangenheit des Schwefelbades Ledde aber wurde ein Raub
der Flammen und ist unwiederbringlich verloren.
|
|
.
 |
 Quelle; 23.7.1992 Westf. Nachrichten
Quelle; 23.7.1992 Westf. Nachrichten
|
|
 |
DHannigbrink
erbaute 1900 das Gebäude - Schwefelbad Ledde:
Ein Haus erzählt seine Lebensgeschichte
Das war das prächtige Haus des Bades Ledde im Jahr 1900. Das
Bild wurde 1907 aufgenommen.
Ledde. Es war einmal ein imposantes Gebäude - das Schwefelbad
Ledde. 1900 wurde es von A. Hannigbrink auf einer kleinen Anhöhe
nahe dem Dorf Ledde erbaut. Es war ein großes Haus, für die
damalige Zeit sehr modern. Große Galerien umgaben den imposanten
Bau, die sicherlich überleiteten zu großen Wandelhallen im Innern.
Eine Brauerei war angeschlossen, deren Schornstein bis zur Vernichtung
durch den Brand 1990 noch an der Rückseite des Hauses zu sehen
war. Bei solchen Bauten gehörte eine Kegelbahn dazu, weil nach
der damaligen Dorfordnung zwar vieles verboten, das "Kegelschieben"
aber erlaubt war, weil es "der Rekreation (Erholung) diente".
Diese Kegelbahn ist heute noch als Gebäude-Rest vorhanden. Im
Laufe der Jahre wurde das Haus, vermutlich aus wirtschaftlichen
Gründen immer kleiner. Im ersten Weltkrieg aber hat es noch
als Feldlazarett gedient. Außerdem wurden die im ersten Weltkrieg
auf der Zeche Perm beschäftigten Polen dort untergebracht.
|
|
 |
Das Bad
war vom früheren Besitzer Hannigbrink - so schreibt Hans Röhrs
in seinem Buch "Der frühe Erzbergbau" an den Georgs-Marien-Bergwerks-
und Hüttenverein (GMV) verkauft worden. Es wurde zu einem echten
Zweckbau umgestaltet. Im Jahre 1938 kaufte Erwin Bischof, der
auch jetzt noch Besitzer ist, das Anwesen, zu dem große Ländereien
gehören. Das beweist am besten die große Scheune, die heute
noch voll funktionsfähig ist, aber zur Ernteunterbringung kaum
noch genutzt wird. Ende August des Jahres 1990 brannte das Wohnhaus
ab, während Scheune und Kegelbahn verschont blieben. Neben dem
Schornstein der früheren Brauerei begann der Brand, der das
Wohnhaus so gründlich zerstörte, dass sich ein Wiederaufbau
in der alten Form als zu kostspielig erwies. Es wurde völlig
abgebrochen und Erwin Bischof entschloss sich, einen neuen Klinkerbau
an die Stelle des alten Hauses zu setzen. Während der Zeit des
Abbruchs und des Neubaus wohnte er mit seiner Frau im Heuerhaus
seines Nachbarn, des Bauern Dresemann. Am 1. Dezember 1991 ist
er in den Neubau eingezogen. So hat ein einstmals bedeutendes
Haus im Kreise Tecklenburg in knapp einem Jahrhundert, genau
genommen sind es gut 90 Jahre, sein "Gesicht" von Grund auf
verändert.
|
|
 |

4.11.1998 - Gesundheitstourismus gab es schon zu Opas Zeiten
Das Tecklenburger Land war einst eine Bädergegend
Von CORNELIA Ruholl |
|
| |
Tecklenburger Land.
Freizeit und Erholung sind keine Erfindungen der heutigen Zeil,
In den 20er Jahren schlug die Geburtsstunde der Sommerrodelbahn
in Ibbenbüren. Am 13. Mai 1926, am Himmel-fahrtstag, stellte
Hermann Derhake diese neue Attraktion vor. Ein" Kinder-Rutschbahn,
die er Anfang der zwanziger Jahre auf einer Kirmes sah, hatte
ihn auf die Idee gebracht, so etwas in großem Stil und als Dauereinrichtung
zu bauen. Nach Eröffnung der Sommerrodelbahn dauerte es aber
noch zehn Jahre, bis sie sich in Ibhenbüren, im Tecklenburger
Land und im weiten Umkreis als Ausflugsziel durchgesetzt hatte.
Heute präsentiert sich die Sommerro-delbahn als eine moderne
Freizeit- und Erholungsanlage, die Ibbenbüren bis ins Ausland
bekannt gemacht hat. Alljährlich zieht sie viele tausend Besucher
an. In Vergessenheit geraten ist dagegen, daß es auch in Bergeshövede
einmal eine Sommerrodelbahn gab, die sogar nach dem Zweiten
Weltkrieg noch in Betrieb war. Sie war am Restaurant zum Rhein-Ems-Kanal
gelegen,
|
|
 |
Hilles Gaststätte, die
jahrzehntelang ein beliebtes Ausflugslokal war. Viele Angebote
auf dem Tourismus-Sektor waren früher ein Privileg der Betuchten.
Dennoch war das Tecklenburger Land einst eine wahre Bäder-Landschaft.
Sogar Ibbenbüren, wenngleich kein Badeort, beherbergte Kurgäste.
Heute gibt es Bäderbetriebe noch in Bad Steinbeck und in Bad
Holthausen. Bad Steinbeck, das in diesem Jahr auf sein 175jähriges
Bestehen zurückblickt, ist erst vor wenigen Jahren einzige staatlich
anerkannte Heilquelle im Regierungsbezirk Münster geworden.
Nach wie vor steht heute bei den modernen Baderbetrieben der
medizinische Aspekt im Vordergrund.
Daneben war aber in den Jahren um die Jahrhundertwende der Besuch
eines Bades auch schick und wurde eng mit dem Freitgedanken
verknüpft, eine Verbindung, wie sie heute wieder in dem Begriff
"Wellness-Urlaub" auftaucht. Damals gab es in den Bädern des
Altkreises Tecklenburg (neben Bad Holthausen und Bad Steinbeck
kannte man früher auch Bad Mettingen und Bad Ledde) regelrechten
Kurbetrieb. Nachdem im 17. Jahrhundert das Badewesen in Nord-
und Mitteleuropa zurückgegangen war, kamen im 18. Jahrhundert
zunächst Seebäder, dann auch geschlossene Badeanstalten wieder
auf. Seit dem 19. Jahrhundert nahm das Badewesen einen großen
Aufschwung, auch das Verständnis für den Wert der Heilbäder
nahm zu, erläutert "Der Neue Brockhaus" zum kulturgeschichtlichen
Hintergrund des Bäderwesens. Ein gewachsenes Verständnis für
den Wert von Heilbädern hatten offenbar auch die Gründer der
zahlreichen Kurhotels und Bäder im Tecklenburger Land. Der Inhaber
des Kurhotels "Waldfrieden" in Ibbenbüren, Vogt, war vergleichsweise
spät dran. 1916 kaufte er das Anwesen vom Gastwirt I.indemann.
Dieser hatte auf dem Gelände, wo von 1852 bis 1870 eine Brauerei
betrieben worden war, eine Gastwirtschaft und Sommerfrische
eröffnet. Vogt machte daraus ein Luftkurhotel mit ainem kleinen
Kurpark. In der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und wahrend der
Inflationsjahre florierte das Luftkurhatel "Waldfrieden". Vorwiegend
zahlungskräftige Ausländer und Zechenhesitzer waren die Gäste,
die dort Erholung suchten. Aber dem Haus war nur eine kurze
Zeit als Kurhotel beschieden. Schon 1924 bot Besitzer Vogt der
Stadt Ibbenbüren das Anwesen mit zwei Wohngebäuden und 9.2 Hektar
Land für 43.000 Mark zum Kauf an. Weil die Stadt zu lange überlegte,
wurde dem Provinzialat der Schwestern vom Guten Hirten in Münster
das günstige Angebot gemacht, der es auf Anraten des Bischofs
Poggenburg und der Landesbehärde annahm. Man hatte schon lange
ein geeignetes Erhohlungshein Schwestern und Mädchen gesucht.
Die Bäder im Tecklenburger Land haben alle eine andere Geschichte.
In den 20er Jahren ging aber für einige die Glanzzeit zu Ende.
Um die Jahrhundertwende hatte der Besuch von Kurbäddern bei
den Betuchten zum guten Ton gehört. Nicht zuletzt die Creme
der russischen Gesellschaft bevorzugte deutsche Kurbäder. Eine
alte Postkarte aus dem Jahre 1900, die das Schwefelbad Ledde
zeigt, belegt, daß man damals auch auf internationales Publikum
eingestellt war. In zehn Sprachen ist das Wort "Postkarte" auf
der Rückseite aufgedruckt. Auffallend ist die Vielzahl der osteuropäischen
Sprachen, darunter auch Russisch.
Für den Betreiber des Ledder Schwefelbades, Ernst-August Hanningbrink,
gehörten Gäste aus dem östlichen Teil Europas also offenbar
zur Zielgruppe. Hannigbrink verkaufte sein Kurhaus, das 1882
feierlich eröffnet worden war, bereits 1908 an den "Georgs-Marien
Bergwerks- und Hüttcnverein A.G.", der dort das Genesungsheim
"Bad Ledde" betrieb. Es war ein großes, für die damalige Zeit
sehr modernes Haus mit großen Galerien, die das Haus umgaben
und großen Wandelhallen im Inneren des Hauses. Auch eine Brauerei
war angeschlossen und eine Kegelbahn gehörte dazu. Im Ersten
Weltkrieg wurde das Anwesen als Lazarett genutzt. Zuletzt gab
es dort einen landwirtschaftlichen Betrieb und im August 1990
wurde das ehemalige Kurhaus durch einen Brand zerstört. Schwefelwasser,
das unter artesischem Druck schon seit Jahrhunderten in Bad
Holthausen aus dem Boden quoll, machte der Bauernsohn August
Holthaus, Begründer vun Bad Holthausen, um das Jahr 1900 Heilzwecken
zugänglich. Mit zwölf Grad Celsius drängt das Calcium-Hydrogenkarbonat-Wasser
dort an die Oberfläche und wird direkt in die Wannen des Badehauses
geleitet. Bis heute wird in Bad Holthausen mit Schwefelwasser-Anwendungen
therapiert. Schon 1823 wurde durch einen Zufall bei der winterlichen
Schilfernte die Steinbecker Schwefelquelle entdeckt. Die wissenschaftliche
Untersuchung des Wassers ergab vornehmlich einen Schwefelgehalt.
So schuf der bäuerliche Besitzer Sundermann dort eine Badeanlage.
Die ersten Badegäste kamen aus der näheren Umgebung, zum Beispiel
aus Beesten, Voltlage, Riesenbeck, Mettingen und Ibbenbüren
und suchten Heilung von Gicht, Hautkrankheiten, Krätze oder
Rheumatismus. Sogar aus den Niederlanden kamen Kranke in das
zunächst recht anspruchslose Bad. 1881 wurde ein neues Badhaus
errichtet, weil das erste Bad, das ein Fachwerkbau mit Mansardendach
gewesen war mit zehn Badezimmern, einem geräumigen Saal und
Logierzimmern, baufällig geworden war. 20 Jahre später wurde
auch das zweite Badehaus durch einen Neubau ersetzt. Als 1900
das Wohnhaus abbrannte, wurde an seiner Stelle ein Neubau mit
zahlreichen Fremdenzimmern errichtet, denn damals hatte der
Besuch von Badegästen in erfreulichem Maße zugenommen, was nicht
zuletzt eine Folge des zuvor beschriebenen Zeitgeistes gewesen
sein mag. Der Bau der Kleinbahn Piesberg - Rheine von 1904 trug
wesentlich zur Förderung des Badebelriebes und des Fremdenverkehrs
in Steinbeck bei. Mitte dieses Jahrhunderts gehörten zu Bad
Steinbeck ein Kurhaus und ein badeärztlich betreutes Badehaus.
Liegewiesen, Tennisplatz und das Waldfreibad in der Nähe rundeten
das Kurmilieu ab. Die Erfolge bei Rheuma, Gicht, Ischias und
Frauenkrankheiten hatten neben den Privatpatienten auch die
Sozialversichcrungsträger aufmerksam werden lassen. In früherer
Zeit kamen auch viele auswärtige Gäste für einen längeren Kuraufenthalt
nach Bad Steinbeck und logierten dort. Heute ist der Bäderbetrieb,
der gerade wieder erweitert und mit modernster Bädertechnik
ausgerüstet wurde, auf ambulante Patienten eingestellt. Wie
in Ledde, Bad Holthausen und Steinbeck nutzte man auch in Bad
Mettingen schwefelhaltiges Wasser. Der Kaufmann Hermann Heinrich
Lampe, genannt Rahe, und seine Frau Juliana Rahe vererbten ihrem
Sohn, dem Kaufmann Carl August Lampe zu Sneek ihr Anwesen, die
Grundstücke genannt "Overgünne". Der Erbe errichtete durt noch
im selben Jahr ein Tüöttenhaus und legte einen schönen Hausgarten
an. Vermutlich bei diesen Arbeiten wurde der Schwefelgehalt
des Wassers entdeckt. Das veranlaßte den Besitzer dazu, ein
Schwefelbad dort einzurichten. Lampe legte einen Kurgarten an,
erbaute westlich seines Wohnhauses einen Kursaal und ließ eine
Kegelbahn anlegen. Dem Saalbau schloß sich die Badeeinrichtung
an, die zunächst sechs Badezellen hatte, denen bald vier weitere
folgten.
Am 20. Mai 1897 beantragte er die Genehmigung zur Aufstellung
eines Kessels zum Badebetrieb. Erfreute sich das Bad zuerst
guten Zuspruchs, so nahm der Badebetrieb allmählich ab, da sich
herausstellte, daß der Schwefelgehalt des Wassers zu schwach
war und Schwefel dem Badewasser zugesetzt werden mußte. Die
Baderäume wurden schon 1888 zu einer Dampfmühle hergerichtet.
Die Anlagen des Bades blieben nach wie vor ein beliebter Luftkurort,
der 1898 durch einen größeren, von Kähnen befahrenen Teich erweitert
und verschönert wurde. Mitten in diesem Teich lagen drei Inseln,
die nach der amerikanischen Insel Cuba benannt wurden. Blieb
Bad Mettingen auch weiterhin eine bevorzugte Sommerwirtschaft,
so ging der Wirtschaftsbetrieb doch langsam zurück, als die
Besitzerin Maria Lampe geb. Hettlage, genannt Bads-Marie, älter
wurde. Als sie 1904 starb, wurde der Besitz verkauft und es
wurde dort eine Zeiltang eine Dampfmolkerei betrieben. 1929
kaufte die katholische Kirchen-gemeinde das Gelände und die
Anlage wurde zu einer großen Gaststätte ausgebaut. Der Saal
wurde vergrößert und auch die darin befindliche Bühne. Der Teich
wurde zugeschüttet, ein Spielplatz und ein Garten sowie eine
Kegelbahn und ein Schießstand wurden dort angelegt. In Sachen
Freizeit und Erholung spielten Anfang dieses Jahrhunderts im
Tecklenburger Land auch die Gartenwirtschaften eine wachsende
Rolle. Das wird auch anhand von Zeitungs-Annoncen aus dieser
Zeit deutlich. Die "Restauration und Pension G. Zänker" in Gravenhorst
warb als "der lohnendste und beliebteste und leicht zu erreichende
Ausflugsort von Ibbenbüren mit idyllischer waldiger Umgebung,
einem großen Teich und Gelegenheit zum Bootfahren. Kegelbahn
usw." um Touristen und Ausflugsgäste. Als "beliebtester Ausflugsort
für Touristen, Schulen, Vereine von Ihbenbürcn. Rhcinc. Münster
und Osnabrück" empfahl sich in einer Anzeige auch Bad Mettingen.
Man warb dort mit schwefel- und eisenhaltigen Quellen als "Sommer-Luftkurort
mit Pension" und pries die "herrlichen, ausgedehnten Parkanlagen
mit schattigen abgeschlossenen Lauben für kleine Gesellschaften
und besonders die "Insel Cuba" in der künstlichen Teichanlage,
die zu Kahnfahrten einlud. Kegelbahn, Spielplätze für Kinder
und ein Karussell gehörten auch hier zur Ausstattung. Ähnlich
las sich eine Anzeige des Schwefelbads Ledde: "Lohnender Ausflugsort
für Touristen und Gesellschaften, Teich mit Kahnfahrt, verdeckte
Kegelbahn, prachtvolle Gartenanlagen in romantischer Lage im
Walde zwischen den Bergen". Als "Heilquelle ersten Ranges" präsentierte
sich "Schwefelbad und Pension Steinheck bei Recke" in einer
Anzeige. Der Besitzer J. Keßling warb mit "feinen Zimmern im
mit allem Comfort ausgestatteten Logierhause. Sehr gute Pension
zu billigen Preisen".
|
|
 |
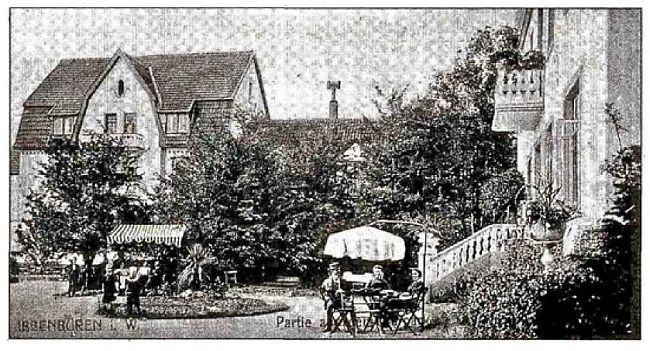
Das Luftkurhotel "Waldfrieden" florierte nach dem Ersten Weltkrieg
und noch in den zwanziger Jahren.
Es beherbergte betuchte ausländische Gäste und Zechenbesitzer.
|
 |
 |
|
 |
| |
Eine alte Postkarte, die zu Beginn dieses
Jahrhunderts gedruckt wurde, zeigt das imposante Kurhaus
von Bad Ledde
|
|
 |
 28.7.2000 - Westf. Nachrichten
28.7.2000 - Westf. Nachrichten
|
|
 |
Ausflug zum alten Schwefelbad
Kneipp-Verein wandert Samstag in Ledde - Abschluss mit Weggenessen
-jbi- Tecklenburg. Wandern am ehemaligen Schwefelbad Ledde will
der Kneippverein morgen. Um 14.30 Uhr ist Treffpunkt auf dem
Marktplatz, um 14.45 Uhr geht es in Fahrgemeinschaften ab Chalonnes-Platz
los. In Ledde wollen die Kneippfreunde (Gäste sind willkommen)
einen Teil des Kneipp-Rundwanderweges erkunden. Abschluss wird
beim gemeinsamen Weggenessen in der Gaststätte Steinigeweg,
Am Stollen 4, sein. Das alte Schwefelbad Ledde wurde von Gastwirt
Ernst August Hannigbrinck angelegt und am 14. Mai 1882 feierlich
eröffnet. Die Quelle trug den Namen Hermannsquelle. Nach kurzer
Blütezeit verkaufte Hannigbrinck den Besitz 1908 für 120 000
Mark an den Georgsmarienhütten-Verein. Im Ersten Weltkrieg war
in den Gebäuden ein Lazarett für verwundete Soldaten. Durch
den Ibbenbürener Bergbau war die Ledder Quelle versiegt, damit
war auch das Bad Geschichte.
|
|
 |
 14.4.2006 - Westf. Nachrichten
14.4.2006 - Westf. Nachrichten
Mondäne Heilquelle. Das Schwefelbad Ledde
schrieb Geschichte
|
|
| |
Tecklenburg
In Ledde wanderte der Geschichts- und Heimatverein (GHV) und schaute
dabei auf die wirtschaftliche Entwicklung der heimischen Region.
Unterwegs fand der alte Windmühlenstandort auf dem Hupenberg das
Interesse der Wanderer. Die Tnexttafel des Ledder Heimatvereins
weist auf den Standort hin, der allerdings nicht einmal zu erahnen
ist. Das sah um 1870 ganz anders ans. Der Auswanderer Heinrich
Handiek (1854 bis 1932) aus dem Grenzbereich Tecklenburg/Ledde,
der sich 1881nach Amerika einschiffte, schreibt 1926 in einem
Bericht, dass er mit einer Schiebkarre das Korn zum Mahlen zur
Windmühle auf dem Brochterbecker Berg, (heute der Bismarckturm)
gebracht habe. ,,Es war mir immer eine schöne Ausschau, wenn ich
von der Tecklenburger Mühle in nordöstlicher Richtung zwei wcitere
Windmühlen, ihre großen Flügel drehend, beobachtete, nämlich die
eine unweit des Dorfes Ledde, die andere auf dem Windmühlenhügel
oberhalh von Westerkappeln." Die 1884 errichtete Mühle auf dem
Hupenberg war eine kombinierte Mahl- und Sägemühle. Nachweislich
war sie um 1900 noch in Betrieb. Das Foto von 1910 zeigt deutlich
den kurzfristigen Verfall, wahrscheinlich hatte sie gebrannt.
Nicht weit entfernt an der A 30, sind vor Jahren zwei große Windkraftanlagen
entstanden. Ähnlich die Entwickluug auf dam Westerkappelner Windmühlenhügel.
Die dort vorhandene Mühle wurde 1904 abgebrochen.
In der Nähe hat der Bauer Wieliginann vor etwa 15 Jahren eine
mittelgroße Windkraftanlage installiert. Das eigentliche Ziel
der Wanderer war die Gaststätte Steinigeweg, die unmittelbar am
früheren "Bad Ledde" in Danebrock liegt. Das war ein Schwefelbad,
das Ernst August Hannigbrink aus Westerkappeln 1832 bauen ließ.
Es wurde empfohlen gegen Gicht. rheumatische Leiden, Ausschläge
oder Flechten. Im Werbeprospekt verweist Hanigbrink auf prachtvolle
Gartenanlagen, eine verdeckte Kcgelbahn, den Saal und den Teich
mit Kahnfahrt. Den "vorzüglichen alten Münsterländer Korn" brannte
der Unternehmer selbst (Kornbrennerei und Brauerei). Gespeist
wurde das Bad von der "Hermansquelle", die später wohl wegen des
sich ausweitenden Ibbenbürener Kohlebergbaus versiegte. 1906 brannte
das Bad ab. Der Besitzer verkaufte es danach an den Georgsmarien-hüttenverein.
Das Unternehmen brachte hier ausländische Arbeiter, vor allem
Kroaten unter. Im Ersten Weltkrieg diente das Gebäude als Lazarett
für etwa 50 verwundete Soldaten, die der Wcstorkappelner Arzt
Dr. Siemon betreute. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde alles wieder
(weiter) verkauft. Im Hauptgebäude entstanden Wohnungen. Es wurde
in den 90er Jahren (1990) erneut ein Raub der Flammen. An einen
Wiederaufbau war ninht mehr zu denken. Heute steht auf dem Grundstück
ein zweigeschossiges Wohnhaus. An die alte Herrlichkeit erinnern
ein gewaltiges Wirtschaftsgebäude und die Teichanlage. Der Ledder
Heimatverein wird im Mai dort eine selbst gefertigte Tafel mit
umfangreichen Informationen aufstellen - . Horst Wermeyer |
|
 |
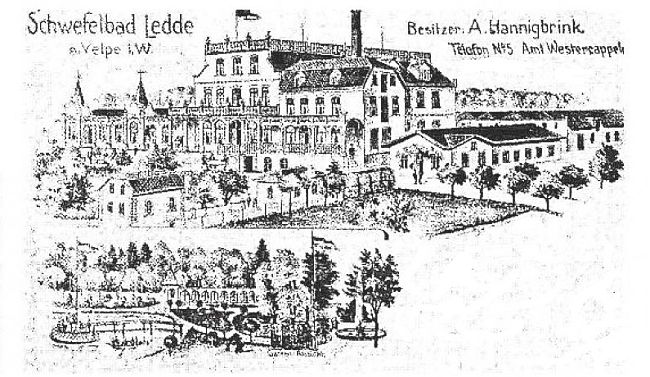
Foto: Sogar Postkarten gab es vom mondänen Schwefelbad Ledde.
Nur die alte Kegelbahn ist von
den imposanten Gebäuden übrig geblieben. |
 |
 |
 1.1.2015 - Bad Ledde - Spurensuche
1.1.2015 - Bad Ledde - Spurensuche
|
|
| |
Meine Erinnerungen an die Umgebung in Ledde sind
noch sehr lebendig und dies haben wir unserem Lehrer Wilhelm
Riesenbeck zu verdanken. Herr Riesenbeck war sehr heimatverbunden
und so erwanderten wir die Heimatgeschichte Leddes. Unterwegs,
so nebenbei, erklärte er uns die Botanik. Es war spannend. So
kamen wir als Ledder Schulkinder eines Tages hinter dem Windmühlenberg
nach Bad Ledde. Nach der Überquerung des Innenhofes der früheren
Kuranlage standen wir hinter dem zum Teil zerstörten Kurhaus,
das als Ruine übrig geblieben war. Die anderen Gebäude waren
noch erhalten. Einige Ledder wohnten dort zur Miete. Wilhelm
Riesenbeck erzählte so spannend mit vielen Erklärungen über
das feudale Bad aus dem 19ten Jahrhundert, dass Fantasiebilder
mit den noch vorhandenen Gebäuden und dem Teich vor unseren
Augen entstanden. Der damalige Besitzer, Herr Bischof bestätigte
diese Ausführungen. Auch sprachen sie von dem Park und den Tanzvergnügungen
im Saal und Garten: Eine Erholung mit Vergnügungen für begüterte
Menschen. Unter anderem soll nach der Jagd im Teutoburger Wald
Kaiser Wilhelm mit seiner Jagdgesellschaft für einige Tage eingekehrt
sein. Weiter wurde im Jahr 1907 Kaiser Wilhelm in der Stadt
Tecklenburg jubelnd mit Fähnchen begrüßt
So erzählte uns unser Lehrer, der all dies selbst als Schüler
erlebt hatte
|
|
| |
Natürlich erklärte er uns auch, wie es zu der
Gründung des Bades gekommen war. Kurz: Die Hermanns-Quelle in
Bad Ledde wurde ab 1882 als Schwefelbad für erholungsbedürftige
und kranke Patienten nach der staatlichen Genehmigung eröffnet.
Die entstandene Einrichtung brachte nicht nur für den Besitzer
Hannigbrinck und Patienten einen Erfolg sondern auch der Bevölkerung
in Ledde. Später wurde das Schwefelbad um ein größeres und modernes
Bad mit Parkanlage erweitert. 500 Meter weiter vom Kurbad entfernt,
befand sich ein unterirdischer Stollen (Permer Stollen) mit
der Erdöffnung. Durch die Öffnung wurde das Erz zu Tage gefördert,
dort gelagert und anschließend per Kleinbahn nach Georgsmarienhütte
transportiert. Durch den damaligen Erzabbau soll eines Tages
die Schwefelquelle allmählich versiegt sein. So ging die Blütezeit
des Schwefelbades dem Ende zu. Nach einem großen Brand wurde
das Bad 1908 aufgegeben und alles nach und nach verkauft. Wir
durften an den Stolleneingang (vom Permer Stollen, der später
verschlossen wurde) gehen und hinein schauen. Dort entdeckten
wir an der Decke Tiere, die wir noch nie gesehen hatten. Lehrer
Wilhelm Riesenbeck erklärte uns, das seien Fledermäuse, die
auch in einem hohen Gebäude in Ledde Dorf hingen. Im 1. Weltkrieg
dienten die erhaltenen Gebäude als Lazarett für die verwundeten
Soldaten. Damals gab es zu wenige Krankenschwestern, so dass
die Ledder Frauen die Soldaten gepflegt haben. Selbst die Essensrationen
reichten nicht aus. So mancher Haushalt brachte heimlich, es
war strengsten verboten, den Soldaten abends etwas zu essen.
Ob die Frauen jemals dafür einen Orden bekommen haben?
|
|
| |
Eine Wanderung führte uns aus Richtung Dorf kommend
in das Gebiet Ledde-Widum unterhalb links vom Windmühlenberg.
Dort ist noch heute die Widum-Quelle. Das Wasser sprudelte aus
der Erde in einen Steintrog mit Überlauf. Für uns Kinder war
das eine Sensation. Das Wasser lief über den Weg in einen Tümpel
den Berg weiter hinunter bis ins Moorgebiet hinter der Osterledder
Straße. An der Widum-Quelle wurde lange Wäsche gewaschen und
das Wasser für die Höfe geholt. Etwas weiter neben der Quelle
wohnte der Holzschuhmacher Birkenkamp, bei dem wir auch zuschauen
durften, wie für Groß und Klein die Holzschuhe hergestellt wurden.
Von dort wanderten wir weiter an dem Fachwerkhof/Pachthof Feldmann
(heute Pelle) vorbei, dann weiter über den Windmühlenberg bis
an die heutige Windmühlenstraße. Dort war die nächste Pause.
Hier hatte vor vielen Jahren eine Windmühle gestanden. Die felsigen
Grundsteine waren noch vorhanden, auf denen wir unser Frühstück
einnahmen und herum hüpften und tanzten. Lehrer Riesenbeck erzählte
uns Schülern, dass die Windmühle einem Herrn Hannigbrinck von
Bad Ledde gehört hatte. Das war für mich interessant, denn uns
gehörte ein Stück Acker und Wiese unterhalb dieser Ruine. Wahrscheinlich
hatte Großvater den Acker von Hannigbrinck gekauft. In Ledde
gab es verschiedene Mühlen, eine Wassermühle, um Korn zu mahlen
und ein Sägewerk zu betreiben. Eine zweite Mühle gab es in Ledde
am Fuße des Berges von Tecklenburg. Ob es dort früher auch eine
Windmühle gab? Auch stand irgendwo eine Ölmühle, in der während
des Krieges und danach zusätzlich selbst gesammelte Bucheckern
zu Öl verarbeitet wurden. Direkt im Dorf Ledde gibt es heute
noch die Wassermühle Hemmer, wo Korn gemahlen und auch Holz
gesägt wurde. Hühner-, Tauben- und Kaninchenfutter konnten wir
dort auch einkaufen. Von der Ruine der Mühle ging es weiter
über den verlängerten Bergrücken Hupenberg zu dem großen Fachwerkhof
Kohnhorst (am Habichtswald). Da unser Lehrer jeden Bewohner
von Ledde kannte, war er immer herzlich willkommen und wir Kinder
durften dort mit dem Wasser aus dem Hofbrunnen unseren Durst
löschen.
Der große hohe Fachwerkgiebel war beeindruckend, besonders die
Inschrift in dem Balken über dem Eingangstor. Durch das Eingangstor
schauten wir auf die Diele, wo rechts und links die Tiere in
Ställen standen. Die Balkensprüche wiesen auf die Namen der
Erbauer und die Jahresdaten hin. Allgemein waren früher die
Segenssprüche auf den Giebelbalken mit der Bitte an Gott versehen,
dass er das Haus, Menschen und Tiere gegen Brand und Blitz schützen
möge. So mancher Spruch lautete auch: " Gott schütze dieses
Haus vor Gefahren und segne alle die da gehen ein und aus."
1880 beantragte Ernst August Hanigbrink die Errichtung eines
Schwefelbades. Die Zustimmung erhielt er 1881 aus Münster nach
einer Wasseranalyse. Die Eröffnung des Bades war am 14. Mai
1882. Die Quelle wurde daraufhin Hermannsquelle genannt. Zunächst
war das Bad für zehn bis zwölf Patienten ausgelegt. Die Kosten
betrugen damals 3 Mark pro Tag und 50 Pfennig für ein Bad. Einige
Jahre danach wurde das Gebäude zu einem größeren und prächtigeren
Bad ausgebaut. 1906 brannten Teile des Gebäudes ab, und das
Schwefelbad wurde deswegen und wegen der immer weniger ergiebigen
Quelle aufgrund des fortschreitenden Erzabbaus geschlossen.
Danach wurde die Anlage für 120.000 Mark verkauft und zur Unterbringung
von ausländischen Arbeitern genutzt. Im Ersten Weltkrieg diente
das Gebäude als Lazarett für 50 Soldaten. Bis 1993 blieb das
Hauptgebäude erhalten, brannte dann jedoch ab. Heute bestehen
nur noch zwei Gebäude, welche derzeit als Wohnhaus genutzt werden
|
|
 |
 WN - 2.1.2015
WN - 2.1.2015
Mit der Kutsche ins Schwefelbad
Tecklenburg-Ledde
Landwirt August Bernhard Hanningbrinck
baut 1880 den Kurbetrieb auf.
|
|
| |
Mit dem Begriff "Bad Ledde" können nur
noch einige Bewohner Tecklenburgs etwas anfangen. Zu lange liegt
die Blütezeit dieses einstmals florierenden Schwefelbades zurück.
Wilhelm Kienemann hat die Geschichte der Einrichtung zusammengefasst
Es begann 1871 mit einem Antrag des Landwirtes August Bernhard
Hanningbrinck zum Bau einer Kornbranntwein-Brennerei auf seinem
Hof in Ledde-Danebrock. Neun Jahre später (1900) folgte ein
Antrag zur Errichtung eines Schwefelbades, sicherlich beflügelt
von den Erfolgen des seit 1822 bekannten Schwefelbades Steinbeck.
Es entstand ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit Gesellschafts-
und Tanzsaal, Kegelbahn sowie einem großem Park mit Teichanlage.
Viele Gäste kamen von außerhalb mit der Eisenbahn und wurden
mit der Kutsche vom nahe gelegenen Bahnhof Velpe abgeholt.
|
|
|
| |
Im Jahr 1903 wurden 1500 Bäder verschrieben.
(1906) brannten die Gebäude über Nacht ab. Trotzdem entschloss
sich August Hannigbrinck noch mit 66 Jahren zum Wiederaufbau
- und zwar größer und prächtiger als vorher. Mit Zunahme der
Kuren stieg der Wasserverbrauch, doch die "Hermannsquelle" lieferte
nur eine begrenzte Menge. Weitere Brunnen wurden gebaut, insgesamt
sieben auf dem eigenen Gelände. Sie konnten den Wasserbedarf
jedoch nicht decken. Weil der Betrieb nicht mehr rentabel war,
verkaufte Hannigbrinck das Anwesen 1908 für 120?000 Mark an
den Georgs-Marien-Hütten- und Bergwerksverein. Vielleicht machte
ihm auch das 1905 gegründete und von einer kräftig sprudelnden
Quelle gespeiste nahe liegende Schwefelbad Holthausen zu schaffen,
sodass er keine Zukunft mehr sah. Bad Ledde wurde im 1. Weltkrieg
als Lazarett genutzt. 1945 wohnten noch 14 Familien in dem ehemaligen
Kurhaus. Die Männer arbeiteten überwiegend im Bergbau. 1990
brannte das Haupthaus ab. Die Besitzerfamilie Bischof errichtete
ein neues Wohnhaus auf dem Gelände. Nur die "Villa", das frühere
Verwaltungsgebäude, Reste der Kegelbahn, ein Teich und die große
Scheune erinnern an die vergangenen glorreichen Zeiten.
Link: Mit der Kutsche ins Schwefelbad - Westfälische Nachrichten
https://www.wn.de/muensterland/kreis-steinfurt/tecklenburg/mit-der-kutsche-ins-schwefelbad-1868133?&npg
|
|
 |
 Postkarten vom Schwefelbad Ledde bei Velpe
Postkarten vom Schwefelbad Ledde bei Velpe
|
|
 |
|
 |
| |
Foto-1 - Das Schwefelbad Ledde in seinen guten
Jahren. Das Bild ist ca. 1907 gemacht worden
|
|
| |
 Quelle - 14.4.2006 Mondäne Heilquelle
Quelle - 14.4.2006 Mondäne Heilquelle
Das Schwefelbad Ledde schrieb Geschichte
|
|
| |
Tecklenburg - In Ledde wanderte der Geschichts-
und Heimatverein (GHV) und schaute dabei auf die wirtschaftliche
Entwicklung der heimischen Region. Unterwegs fand der alte Windmühlenstandort
auf dem Hupenberg das Interesse der Wanderer. Die Tnexttafel
des Ledder Heimatvereins weist auf den Standort hin, der allerdings
nicht einmal zu erahnen ist. Das sah um 1870 ganz anders ans.
Der Auswanderer Heinrich Handiek (1854 bis 1932) aus dem Grenzbereich
Tecklenburg/Ledde, der sich 1881nach Amerika einschiffte, schreibt
1926 in einem Bericht, dass er mit einer Schiebkarre das Korn
zum Mahlen zur Windmühle auf dem Brochterbecker Berg, (heute
der Bismarckturm) gebracht habe. ,,Es war mir immer eine schöne
Ausschau, wenn ich von der Tecklenburger Mühle in nordöstlicher
Richtung zwei wcitere Windmühlen, ihre großen Flügel drehend,
beobachtete, nämlich die eine unweit des Dorfes Ledde, die andere
auf dem Windmühlenhügel oberhalh von Westerkappeln."
|
|
| |
Die 1884 errichtete Mühle auf dem Hupenberg
war eine kombinierte Mahl- und Sägemühle. Nachweislich war sie
um 1900 noch in Betrieb. Das Foto von 1910 zeigt deutlich den
kurzfristigen Verfall, wahrscheinlich hatte sie gebrannt. Nicht
weit entfernt an der A 30, sind vor Jahren zwei große Windkraftanlagen
entstanden. Ähnlich die Entwickluug auf dam Westerkappelner
Windmühlenhügel. Die dort vorhandene Mühle wurde 1904 abgebrochen.
In der Nähe hat der Bauer Wieliginann vor etwa 15 Jahren eine
mittelgroße Windkraftanlage installiert. Dtm eigentliche Ziel
der Wanderer war die Gaststätte Steinigeweg, die unmittelbar
am früheren "Bad Ledde" in Danebrock liegt. Das war ein Schwefelbad,
das Ernst August Hannigbrink aus Westerkappeln 1832 bauen ließ.
Es wurde empfohlen gegen Gicht. rheumatische Leiden, Ausschläge
oder Flechten. Im Werbeprospekt verweist Hanigbrink auf prachtvolle
Gartenanlagen, eine verdeckte Kcgelbahn, den Saal und den Teich
mit Kahnfahrt. Den "vorzüglichen alten Münsterländer Korn" brannte
der Unternehmer selbst (Kornbrennerei). Gespeist wurde das Bad
von der "Hermansquelle", die später wohl wegen des sich ausweitenden
Ibbenbürener Kohlebergbaus versiegte. 1906 brannte das Bad ab.
Der Besitzer verkaufte es danach an den Georgsmarienhüttenverein.
Das Unternehmen brachte hier ausländische Arbeiter, vor allem
Kroaten unter. Im Ersten Weltkrieg diente das Gebäude als Lazarett
für etwa 50 verwundete Soldaten, die der Wcstorkappelner Arzt
Dr. Siemon betreute. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde alles wieder
verkauft. Im Hauptgebäude entstanden Wohnungen. Es wurde in
den 90er Jahren (1991?) des vorigen Jahrhunderts erneut ein
Raub der Flammen. An einen Wiederaufbau war ninht mehr zu denken.
Heute steht auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Wohnhaus.
An die alte Herrlichkeit erinnern ein gewaltiges Wirtschaftsgebäude
und die Teichanlage. Der Ledder Heimatverein wird im Mai dort
eine selbst gefertigte Tafel mit umfangreichen Informationen
aufstellen. Horst Wermeyer Foto
|
|
| |
 Quelle - 20.6.2006 Schwefelbad Ledde einst Touristen-Magnet
Quelle - 20.6.2006 Schwefelbad Ledde einst Touristen-Magnet
Heimatverein stellt stabile Infotafel auf
|
|
| |
Teuklenburg-Ledde. Das marode Wirtschaftsgebäude
und die von Büscheu völlig verdeckte alte Kegelbahnanlage mit
Teich sind die letzten Zeitzeugnisse des einstigen Schwefelbads
Ledde. Rund 50 Mitglieder des Heimatvereins Ledde und weitere
interessierte Gäste tummelten sich Freitagnachmittag an der
Abzweigung Windmühlenstraße und Danebroker Esch. Die Gruppe
"Alte Kunst" des Hcimatvereins hatte in mehrmonatiger Arbeit
eine Infotafel zum ehemaligen Schwefelbad auf dem Hof Hanningbrink
gebaut. Gerahmt von einer Plexiglasscheibe gaben alte Fotografien,
eine Urkunde, Texte und eine Federzeichnung den Besuchern der
Region Kenntnis über dieses historische Kulturgut. Schon um
1880 hatte Ernst-August Hanningbrink aus Westerkappeln die Errichtung
eines Schwefelbads beantragt. Nach zwei Jahren Bauzeit konnte
die prachtvolle Anlage am 14. Mai 1882 feierlich eröffnet werden.
|
|
|
| |
Eine aufwendig angelegte Gartenanlage, eine
Kegelbahn, der Gesellschaftsteil, ein Teich für Kahnfahrten
und natürlich die sechs Schwefelbäder boten den zahlreichen
Touristen und Gcsellschaften Erholung pur. Nach einem schweren
Brandschaden wurde die Anlage im Jahre 1906 um eine Kornbrennerei,
ein Stallgebäude und eine Meierei erweitert. Im Ersten Weltkrieg
diente sie als Lazarett. Ein weiterer Großbrand im August 1990
legte das mächtige Hauptgcbäude in Schutt und Asche. Heute steht
auf dem Gelände ein zweigeschossiges Wohnhaus. Der Heimatverein
Ledde hat sich einer großartigen Kulturaufgabe gestellt und
kontruktive Arbeil zum Erhalt von Kultur geleistet, betonte
der stellvertretende Bürgermeister Klaus Holthaus in seinen
Grußworten. So hat die zehnköpfige Gruppe "Alte Kunst" in mehrmonatiger
Arbeit und mit gespendeten Materialien ein fast vergessenes
Erbe kultureller Geschiehte der Region interessant nachkonstruiert.
"Historisches in Erinnerung rufen und für nachfolgende Generationen
erhalten", dieses Ziel betonte der Vorsitzende Hans Timmermann
in seiner Festrede zum Arbeitshintergrund der aktiven Gruppe
seines Heimatvereins ergänzend.
|
|
| |
 Quelle - 100 JAHRE: JAHR FÜR JAHR - 1898/99 - 1998/99
Quelle - 100 JAHRE: JAHR FÜR JAHR - 1898/99 - 1998/99
Die wöchentliche Dokumentation zum Jubiläum der Ibbenbürener
Volkszeitung Nr. 13
|
|
| |
Die Jahre 1926 u. 1927 Der Tourismus hat im
Tecklenburger Land wirtschaftlich schon früh eins Rolle gespielt.
Auch damals lag der Schwerpunkt schon auf Naherholung. Gäste
auch aus dem weiteren Umland und sogar aus dem Ausland lockten
die Bäder in diese Region, die einst eine wahre Bäder-Landschaft
waren. Schon im vergangenen Jahrhundert wurden Schwefelquellen
in Mettingen, Ledde, Holthausen (Tecklenburg) und Steinbeck
(Recke) entdeckt. Die Besitzer des Geländes erkannten den medizinischen
und ökonomischen Wert der Quellen und errichteten Badehäuser,
in denen Schwefel- und Moorbäder sowie Trinkkuren verabreicht
wurden. Während Bad Steinbeck und Bad Holthausen sich weiterentwickelten
- dort werden heute noch Bäderbetriebe geführt, verschwanden
Bad Mettingen und Bad Ledde von der Bildfläche. In Mettingen
haperte es am Schwefelgehalt des Wassers. Das Anwesen in Ledde
(Bild unten rechts) verkaufte der Besitzer A. Hannigbrink nach
dem Ersten Weltkrieg an die GM-Hüttenwerke, die dort ein Genesungsheim
betrieben.
|
|
|
| |
Das Bild links oben zeigt Kurgäste vor dem Badehaus
in Bad Steinbeck zu.Beginn dieses Jahrhunderts. Die Gäste des
Bades bildeten zumeist eine muntere Kurgesellschaft, denn in
der ruhigen Umgebung war geselliges Miteinander, zum Beispiel
bei "Pannekoken-Abenden" öder beim Kartenspiel willkommene Zerstreuung.
|
|
 |
 Ledde - Karten
Ledde - Karten
|
|
 |
|
 |
| |
Karte 1 zeigt
die Stelle, wo sich Bad Ledde befunden hat. Um 2015 ist der
Name des Eigentümers Hukriede
, dieser Name ist in der Karte eingetragen. Kartengrundlage
TIM-online NRW
|
|
 |
|
 |
| |
Karte 2 ist ein
Luftbild von 2020. Wo die Hausnummer 54 in der Karte steht,
dort stand damals das
Hauptgebäude von Bad Ledde Kartengrundlage TIM-online NRW
|
|
 |
|
 |
| |
Karte 3 - Das
Bad befand sich dort, wo der Name Bischof (später Hukriede)
in der Karte steht. Nördlich von Bischof ist dier A 30 mit dem
Rastplatz Brockbachtal. Weiter nördlich verläuft die Bahnlinie
von Osnabrück nach Rheine. Neben der Bahn ist die Straße von
Velpe nach Laggenbeck zu sehen. Das Schwefelbad Ledde lag in
der Bauerschaft Ledde-Danebrock. Nordöstlich vom Bad liegt der
Ort Westerkappeln-Velpe mit der
Bahnstation ganz in der Nähe.
|
|
 |
|
 |
| |
Karte 4 - Auf dieser
Karte sind die Gebäude vom Schweflbad Ledde noch eingetragen,
auch der Name des Eigentümers Hanigbrink. Oben links verläuft
die Bahn nach Rheine und daneben die Straße nach Laggenbeck.
Der Permer Stollen und die Erzbahn nach Georgsmarienhütte ist
oberhalb von Hanigbrink eingetragen. Kartengrundlage Arcanum
Maps - Mapire 1877 Preußen
|
|
 |
Ledde - Eine Dorfchronik
von Brigitte Jahnke
Hrsg. Brigitte Jahnke, 2010
187 Seiten
Stadtmuseum Ibbenbüren - Im Bestand |
|
|
 |
|
|
 Ledde Buch: Ledde,
eine Dorfchronik (2010) Seite 73 - Schwefelbad Ledde
Ledde Buch: Ledde,
eine Dorfchronik (2010) Seite 73 - Schwefelbad Ledde
von Karl-Heinz ZIMMERMANN, Ledde |
|
 |
Lässt der Besucher von Ledde den Blick vom Windmühlenberg
zum Schafberg schweifen, freut er sich über die wenig zersiedelte
Hügellandschaft mit Wiesen und Wäldern. Der Ortskundige wird
ihm dann sagen: "Da unten liegt Bad Ledde!" Das wird einiges
Erstaunen hervorrufen, denn von einem Bad ist weit und breit
nichts zu sehen. Doch das war nicht immer so. Hier gab es früher
ein Kurhaus mit regem Badebetrieb. Auf dem Hof Hannigbrinck
in Ledde - Danebrock gibt (gab) es seit Jahren eine Quelle,
die von der Bevölkerung zu Heilzwecken genutzt wird. Sie entspringt
aus Tonschieferschichten, die Schwefelkies enthalten und wird
einen eindeutigen Schwefelgeruch gehabt haben. Das Vorkommen
dieser Heilquelle ist kein Zufall, sondern hat seinen Grund
in den geologisch - tektonischen Verhältnissen dieser Gegend.
Verfolgt man auf einer Landkarte das Tal zwischen Teutoburger
Wald und Wiehengebirge von Ost nach West, liegen Bäder wie Pyrmont,
Oeynhausen, Salzuflen, Rothenfelde, Laer, Iburg u. a. wie aufgereiht
hintereinander. Diese Linie bezeichnet man als Piesberg - Pyrmonter
Achse. Verlängert man sie nach Westen, gehören auch Bäder wie
Ledde, Holthausen, Mettingen, Steinbeck u. a. noch dazu. Ihre
Entstehung verdanken sie den Verwerfungen, die ihren Ursprung
in der Auffaltung von Teutoburger Wald und Wiehengebirge während
des Überganges von der Kreidezeit zum Tertiär haben. August
Bernhard Hannigbrinck wird im Jahre 1839 in Ledde - Danebrock
geboren.
Seine Eltern bewirtschaften hier einen Hof, der früher zum Gut
Velpe gehörte. Über Jugend und Ausbildung von Bernhard August
ist nichts bekannt. Jahre später wird sein Bruder geboren, der,
wie im Münsterland üblich, der Hoferbe ist. 1871, der deutsch
- französische Krieg ist gerade beendet, taucht der Name Hannigbrinck
wieder auf. Im Archiv der Stadt Tecklenburg befindet sich ein
Antrag von August Bernhard zum Bau einer Kornbranntwein-Brennerei
in Danebrock. Dem Ersuchen wird stattgegeben und auf dem Hof
wird eine Anlage gebaut. 1873 heiratet er Maria Jost aus Lintorf,
die 1849 geboren ist. Aus der Ehe gehen vier Kinder hervor,
zwei Jungen und zwei Mädchen. Der Branntwein muss gut gewesen
sein, denn die Brennerei floriert. Aus Sicherheitsgründen muss
der Dampfkessel alle zwei Jahre auf seine Funktionstüchtigkeit
überprüft werden. Darüber gibt es im Archiv ausführliche Protokolle,
die belegen, dass die technische Überwachung wichtig genommen
wurde.
Dann, im Jahre 1880, der nächste Antrag: August will in Ledde
- Danebrock ein Schwefelbad errichten. Er ist jetzt 41 Jahre
alt. Zehn Jahre besitzt er die Brennerei und der Ertrag daraus
wird ihn ermutigt haben, seine Pläne zu verwirklichen. Der Bau
eines Heilbades in dieser abgeschiedenen Lage ist ein Wagnis,
das Unternehmungsgeist und erhebliche finanzielle Mittel erfordert.
Er wird sicherlich die Entwicklung der Bäder in der weiteren
Umgebung genau beobachtet und sich über die wirtschaftlichen
und verkehrstechnischen Verhältnisse informiert haben. Der Hof
wird umgebaut. Es entsteht ein zweistöckiges Fachwerkhaus mit
hohem Giebel. Er lässt einen großen Park anlegen. Darin befinden
sich drei Teiche, auf denen man mit dem Kahn fahren kann. Eine
Kegelbahn entsteht. Ein unternehmungs-lustiger Mann, der da
in Ledde seine Pläne verwirklicht. Zwei Jahre später ist die
Eröffnung. Für die damalige Zeit sicher ein großes Ereignis.
Die Hermannsquelle, Ausgangspunkt für die Gründung von Bad Ledde,
lieferte einer offiziellen Analyse nach heilkräftiges Wasser.
Dieses wurde in sechs Eichenbadewannen gefüllt und mit Dampf
erhitzt. Behandelt wurden Gicht, Rheuma, Ausschlag usw. Zwölf
Kurgäste konnten zu einem Tagessatz von drei Mark untergebracht
werden. Kuren konnte man vom 15. Mai bis Ende September. In
der heutigen Zeit besuchen wir ein Heilbad hauptsächlich aus
medizinischen Gründen. Um die Wende des vorigen Jahrhunderts
galt ein Aufenthalt als schick und war einem heutigen Wellness
- Urlaub gleichzusetzen. Man erholte sich auf dem Lande, in
der Sommerfrische.
|
 |
 |
|
 |
| |
© Foto Die alte Wetterfahne von Bad Ledde
Foto: Zimmermann
|
|
 |
Weil sich der Betrieb nicht mehr lohnt, die Kosten aber weiterhin
hoch sind, verkauft er das Anwesen 1908 für 120 000 Mark an
den Georgs - Marien - Hütten- und Bergwerksverein.Was so erfolgreich
begonnen hatte, endete leider wenig erfreulich: Die kurze Blüte
von Bad Ledde war vorbei. Ab 1908 wohnen fünfzig Gastarbeiter
aus Kroatien in dem Haus. "Das Lager" wird es im Volksmund genannt.
Die Männer arbeiten im nahe gelegenen Bergwerk (Perm). Mit der
Elektrifizierung der Erzwäsche am Permer Stollen gibt es eine
kleine Sensation in Danebrock, die erste Straßenbeleuchtung.
Der Weg vom Permer Stollen bis zum Lager wird beleuchtet. Schnell
ist der passende Namen gefunden: Füerstraude (Feuerstraße).
Mit dem Ende des Erzbergbaus ist es wohl auch mit der Füerstraude
vorbei, die Gastarbeiter verlassen Bad Ledde.
Während des 1. Weltkrieges von 1914 -1918 ist das Haus dann
Lazarett für fünfzig Verwundete, die hier untergebracht und
gepflegt werden. Dr. Simon aus Westerkappeln ist für die medizinische
Behandlung zuständig. Obwohl A.B. Hannig-brick 1911 gestorben
war, gibt es Briefe von Soldaten, die sich bei Hannigbrincks
für die gute Pflege bedankt haben. Das Haus muss demnach weiter
(von H. als Pächter?) bewirtschaftet worden sein. Eine Zeitzeugin
berichtet von einer Doppelhochzeit, die 1919 "auf Hannigbrinck"
gefeiert wurde, und bei der sie als Kind durchs Fenster geguckt
hat. 1928/29 werden Festsaal und Säulengang abgerissen. Herr
Hollenberg (Danebrock 7) berichtet, dass sein Vater beim Abriss
geholfen hat. Einige Säulen wurden als Fundament beim Bau von
Hollenbergs Scheune verwendet und sind heute noch zu erkennen.
Und auch der Wetterhahn, der einst den Festsaal zierte, dreht
sich heute noch auf dem Dach der Scheune. Er ist also schon
hundert Jahre alt - alle Achtung!
Ledde Buch: Ledde,
eine Dorfchronik
|
 |
 |
|
 |
| |
Briefkopf des Schwefelbades Ledde bei Velpe
|
|
 |
1937 pachtet Familie Langehenke das Anwesen.
1939 kauft A . Bischof Haus und Stallgebäude.
1945 wohnen 14 Familien in dem ehemaligen Kurhaus. Die
Männer arbeiten überwiegend im Bergbau.
1990 brennt das Wohnhaus völlig ab. Ein neues Zweifamilienhaus
wird errichtet. Nur die "Villa" (das
ehemalige Verwaltungsgebäude, die Reste der Kegelbahn,einer
der drei Teiche und die große Scheune
erinnern an vergangene Zeiten.
|
 |
|
|
 Wasserversorgung
im Tecklenburger Land einst und heute
Wasserversorgung
im Tecklenburger Land einst und heute |
|
| |
Auszug aus dem Buch von von Hugo Strothmann
(Autor), |
|
| |
.Bad
Ledde
Das Schwefelbad Ledde stand ehemals im Bereich der Windmühlenstraße
Abzweigung Danebrocker Esch. Heute befindet sich dort das neue
Wohnhaus Bischof, nebenan steht noch das alte Stallgebäude.
Es hatte früher mehrere quer stehende Satteldächer, da die Kehlen
jedoch immer undicht wurden, hat man das ganze Gebäude mit einem
Satteldach versehen. Auf alten Postkarten ist das Gebäude noch
mit den querstehenden Satteldächern zu sehen. Ebenfalls sind
noch die Reste der ehemaligen Kegelbahn, der Teich und das Verwaltungsgebäude
sowie kleine Nebengebäude vorhanden. Ein Problem bestand darin,
daß im Bereich des Schwefelbades kein geeignetes Trinkwasser
war. Auch die Tiere tranken das Wasser nur mit Widerwillen.
|
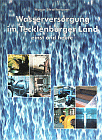 Wasserversorgung
Wasserversorgung
im Tecklenburger Land |
|
 |
Um aber an gutes Trinkwasser zu kommen, hat
man eine Quelle gefaßt, die etwa 300 m oberhalb des Wohnhauses
Schwarze, Windmühlenweg 50, im dichten Fichtenwald entspringt
(Quelle vom Danebrocksbach, südöstl. der Einmündung Danebrock
in die Windmühlenstr.). Von hier aus wurde eine 1,3 km lange
Stahlleitung verlegt. Um 1975 ist die alte Leitung durch eine
2-Zoll-Kunststoffleitung ersetzt worden. Bis 1991 nutzte man
das Quellwasser als Trinkwasser, noch heute dient es zur Gartenbewässerung
und zum Tränken der Tiere. Die Bewohner des Wohnhauses werden
aus der zentralen Wasserleitung versorgt.
|
 |
 |
Seite 138
Geschichtliches zu Bad Ledde -
Auf dem Hof Hannigbrinck wird eine Schwefelquelle mit heilender
Wirkung gewesen sein, die nur der umliegenden Bevölkerung bekannt
war und gelegentlich genutzt wurde. Um 1880 beantragte Ernst-August
Hannigbrinck die Errichtung eines Schwefelbades. Da die Quelle
nicht genügend Wasser lieferte, sind zwei Schachtbrunnen ins
Schiefergestein niedergebracht worden. Um das Einbrechen des
losen Gesteins zu verhindern, hat man die Brunnen mit Natursteinen
ausgekleidet. Sie sollen einen Durchmesser von 1,80 m und eine
Tiefe von 12 m gehabt und den Namen "Hermannsquelle" getragen
haben. Ein Brunnen wurde später durch den Saalbau überbaut.
Die feierliche Eröffnung fand am 14. Mai 1882 statt, zunächst
konnten nur 10 bis 12 Kurgäste untergebracht werden. Der Tagessatz
lag bei 3 Mark, jedes Schwefelbad kostete 50 Pfennig.
|
 |
 |
|
 |
| |
Wasseranalyse der Hermannsquelle Bad Ledde
um 1904. Deutsches Bäderbuch von 1907,
Verlag von J.J. Weber, Leipzig.
|
|
 |
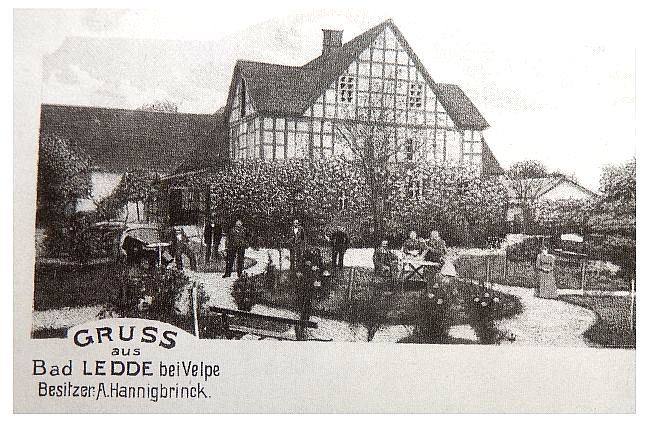
|
 |
| |
Bad Ledde bei Velpe um etwa 1890 - Postkarte
Howe
|
|
 |
Nach dem Brand ist das Schwefelbad wieder aufgebaut
worden. Neben dem Hauptgebäude gab es 1906 auch noch eine Kornbrennerei
sowie ein Stallgebäude, wo gleich die Abfälle der Kornbrennerei
an die Schweine verfüttert wurden. Wahrscheinlich war auch reichlich
Milchvieh vorhanden, denn man betrieb dort eine eigene Meierei.
Die Gebäude rechts auf der Postkarte von 1885 sollen die Badehäuser
gewesen sein.
|
 |
 |
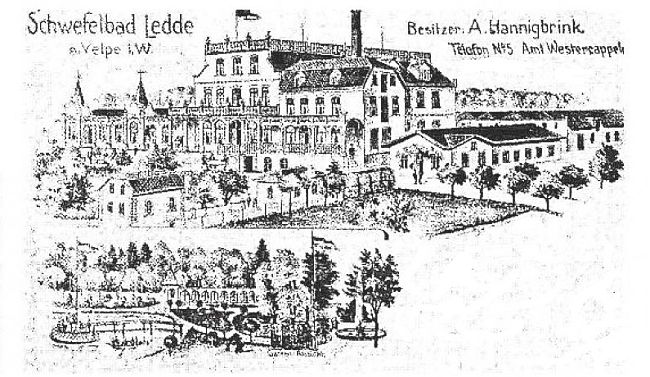
|
 |
| |
Diese Postkarte zeigt das Schwefelbad in seiner
ganzen Pracht. Postkarte: Archiv IVD
|
|
| |
Dahinter ist das Stallgebäude mit den querliegenden
Satteldächern zu sehen. Dieses Gebäude steht noch heute, hat
jedoch, wie beschrieben, ein Satteldach bekommen. In der Mitte
der Postkarte ist das Hauptgebäude abgebildet mit der Veranda
und dem Eingangsportal. Das Gebäude links neben dem Hauptgebäude
(mit den zwei Türmchen) beherbergte den Gesellschaftssaal, in
dem oft Tanzveranstaltungen stattfanden. Vorn links ist das
kleine Wohnhaus zu erkennen, in dem später der Verwalter der
Georgsmarienhütte wohnte. Auf dem unteren Teil der Karte -Gartenansicht-
sieht man den noch heute vorhandenen Teich sowie die zum Teil
noch existierende offene Kegelbahn. Dieses Gebäude ist in einem
baufälligen Zustand, steht aber unter Denkmalschutz. Das frühere
Verwaltungsgebäude gehört heute der Familie Bernd-Dieter und
Reinhild Haskamp. 1905 stieg die Zahl der Kurgäste auf 112.
Im Jahrew 1903 betrug sie 70, im Jahr darauf (1904) waren es
nur 40, bedingt durch den Brandschaden. Nach dem Brand ist das
Schwefelbad wohl zu pompös wiedererstellt worden. Die Belastungen
waren dadurch sehr hoch.
|
|
|
| |
|
Alter Werbeprospekt vom Bad Ledde.
|
|
 |

|
 |
| |
Hermann Nietiedt kutschierte einst mit dem
Gespann von Hannigbrink die Gäste von und zum Bahnhof Velpe,
1903. Foto: Walter Nietied - Seite141
|
|
 |

|
 |
| |
 Seite 142
Seite 142 - Das Genesungsheim "Bad Ledde" des Georgs-Marien-Bergwerks-
und Hüttenvereins um 1916.
Postkarte: Archiv IVD |
|
 |
-650.jpg)
|
 |
| |
Das Hauptgebäude um 1985 Foto: Bischof
|
|
 |
Da die Ergiebigkeit der Quellen nachließ,
angeblich durch den Erzabbau, verkaufte 1908 der Besitzer das
Anwesen an den "Georgs-Marien Bergwerks- und Hütten-Verein A.G.".
Im ersten Weltkrieg nutzte man das Gebäude als Lazarett für verwundete
Soldaten. Einen Teil des Haupthauses und das Stallgebäude des
ehemaligen Ledder Bades kaufte 1939 die Familie August Bischhof.
Durch mündliche Überlieferungen weiß Wolfgang Huckriede, daß 7
Brunnen auf dem Grundstück gewesen sein sollen. Zwei davon habe
man beim Überfahren vor dem Bau des neuen Hausesgefunden. Die
Eichenbohlen, mit denen die Brunnen abgedeckt waren, hatten nachgegeben,
darauf wurden die Brunnen verfüllt. Beim Abbruch des abgebrannten
und beim Bau des neuen Hauses fand man noch drei Brunnen und hat
sie ebenfalls verfüllt. Ein Brunnen befindet sich noch heute etwa
28 m vom neuen Wohnhaus entfernt in südöstlicher Richtung und
ein zweiter östlich des Neubaus in der Wiese. Beide sind mit Deckeln
und Erdreich abgedeckt. Die Brunnen waren aus Naturstein-Schiefergestein
hergestellt. |
 |
 |

|
 |
| |
143 - Das Hauptgebäude wurde am 6.8.1990
ein Raub der Flammen. Foto: Bischof
|
|
 |
Bei Ausschachtungsarbeiten stellte man
fest, daß alle Brunnen untereinander mit Rohrleitungen verbunden
waren. Es hat den Anschein, als sei der Brunnen, der in östlicher
Richtung des Hauses stand, ein Sammelbrunnen gewesen, dem durch
eine Heberleitung das Wasser aus den anderen Brunnen zufloß. Aus
dem Sammelbrunnen wurde das Schwefelwasser für das Bad gefördert
|
 |
 |

|
 |
| |
 Seite 144
Seite 144 - Reste der damaligen Kegelbahn (östlich an der
Windmühlenstr.), im Jahr 1998. Sie soll heute unter
Denkmalschutz stehen. Foto: Strothmann |
|
 |
Anmerkung:
Die letzten Informationen bekam ich von Luise Bischof, Elfriede
Hannigbrink, Wolfgang Huckriede, Walter Nietiedt sowie Herbert
Becker.
Legende zur Karte mit den 7 Brunnen:
Brunnen 1 - die Lage ist nicht bekannt.
Brunnen 2 + 5 wurden vor dem Brand 1990 verfüllt.
Brunnen 3 + 6 wurden nach dem Brand 1990 verfüllt.
Brunnen 4 ist mit einer Schlackenbetondecke und Boden abgedeckt.
Brunnen 7 ist mit einer Betonplatte und Boden abgedeckt.
Brunnen 4 - die Bemaßung ist richtig. Die Bemaßungen der anderen
Brunnen sind nicht bindend, sondern wurden nach mündlichen Überlieferungen
vorgenommen.
Ledde, den 24.2.2001 W. Huckriede / H. Strothmann
Karte (
Die Karte ist unscharf, sie wurde daher nicht übernommen) Die
ungefähre Lage der 7 Brunnen. Zwei davon sind noch heute vorhanden.
|
 |
|
© Förderverein Stadtmuseum Ibbenbüren
e. V.
Breite Straße 9 - 49477 Ibbenbüren
|
|
|
|
|